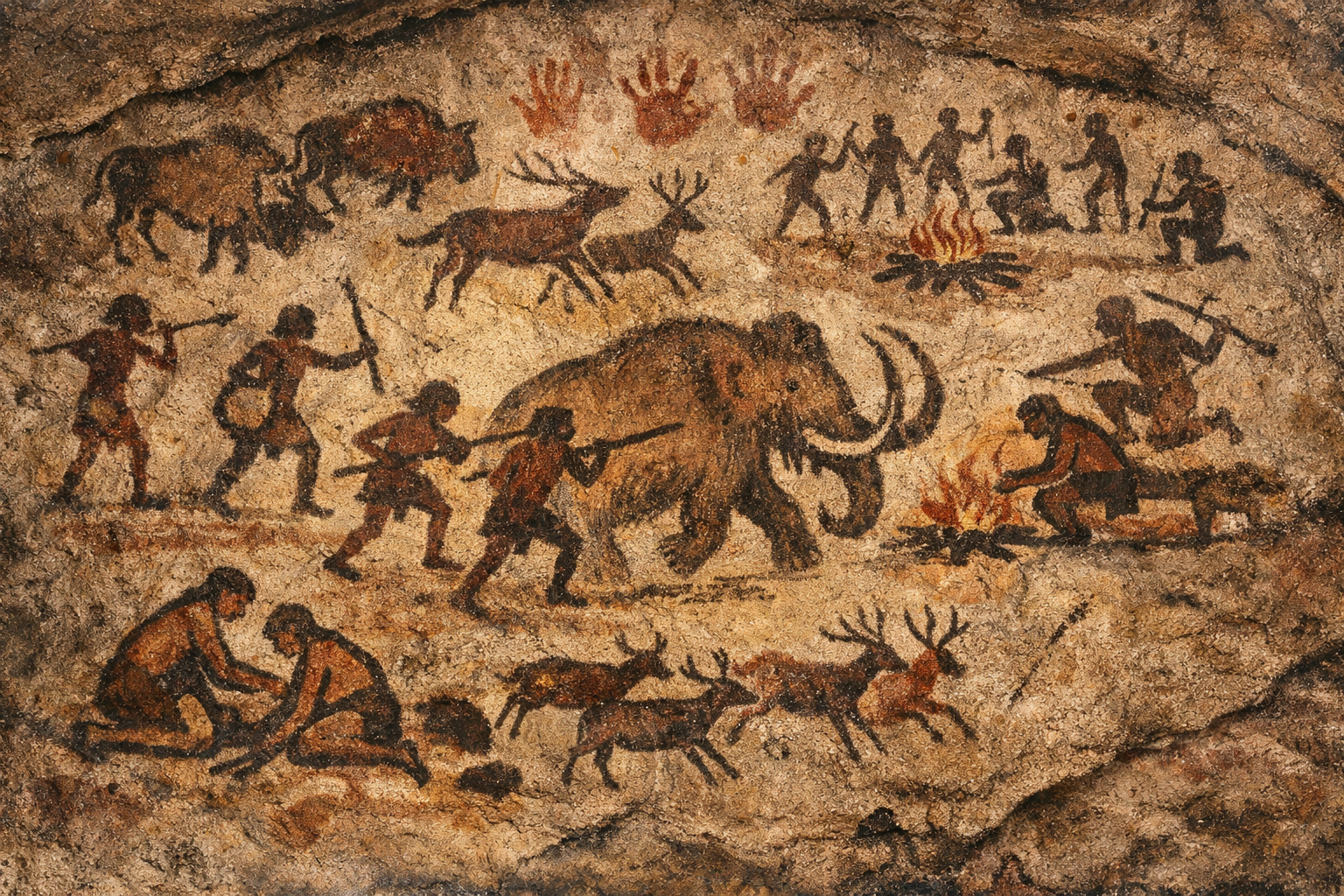Warum sind Menschen homophob?
Psychologische Ursachen der Homophobie
Lesen Sie in diesem Artikel über die psychologischen Ursachen der Homophobie, und was Homonegativität mit Narzissmus und Traumen zu tun hat.

Interview mit mir zum Thema Homophobie und Negativität gegenüber LGBTIQA*
Danke an FS1 Queer*beet – Diversity in Salzburg, dass Ihr Euch des Themas annehmt!!
Homophobie ist eine narzisstische bzw. dissoziale Verhaltensweise
Es gibt eine veraltete psychoanalytische Hypothese, welche postuliert, dass homophobe Menschen selbst homosexuell seien. Dieser Annahme kann ich nur widersprechen. In sehr seltenen Fällen mag dies der Grund sein, doch sind die Hintergründe in der Regel vielschichtiger und komplexer.
Bereits Theodor Adorno, Erich Fromm und Arno Gruen haben beschrieben, dass eine autoritäre Kinderstube dazu führen kann, dass ein Mensch seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle stark unterdrückt, ein falsches Selbst und eine autoritäre Charakterstruktur ausbildet. Derartige Menschen unterwerfen sich gerne Ideologien und Führern und brauchen immer einen Feind im Außen, den sie hasserfüllt bekämpfen, um die eigene Unsicherheit in der Identität nicht zu spüren. Sie entwickeln dann gerade auf Menschen, die ihre Identität gefunden haben und frei ausleben können, Hass, den sie auch durch emotionale Gewalt, verschiedene Formen von Diskriminierung und körperliche Gewalt ausleben. Je fragiler ich bin, desto mehr suche ich mir Feinde im Außen und ordne mich starken Führer*innen unter.
Eine derartig unsichere Person wertet sich selbst auf narzisstische Weise auf, indem sie andere Personengruppen abwertet. Die Abwertung richtet sich gegen alles, was fremd und anders ist, etwa gegen LGBTIQA*, das andere Geschlecht, gegen Personen mit ausländischen Wurzeln etc.
Kinder, die liebevoll aufwachsen, haben es nicht notwendig, den Feind im Außen zu suchen.
Stabile Menschen, die sich sicher fühlen, haben ein differenziertes Weltbild, gehen offen auf andere und Fremde zu und setzen sich mutig mit anderen Weltbildern auseinander.
Dies erklärt, warum auch sexistisch sozialisierte Frauen (etwa Frauen aus Freikirchen, Muslime und orthodoxe Jüd*innen) homophob gegenüber LGBTIQA* sind. Ein gutes prominentes Beispiel dafür ist Beatrix von Storch von der AFD.
Diese Frauen geben dadurch eigene erlitten Traumen an andere weiter. Damit handelt es sich bei ausagierter Homophobie um einen malignen narzisstischen Copingmechanismus. Die Betroffenen sind nämlich meist nicht dazu bereit, sich in Psychotherapie zu begeben oder andere gesunde Strategien zu entwickeln, um ihr fragiles Selbst zu stärken und eigene Traumafolgesymptome in den Griff zu bekommen.
Gesunde Menschen, die Homophobie bemerken, werden dafür Verantwortung übernehmen und sich tiefgehend mit ihrer Negativität auseinandersetzen. Narzisstische Menschen hingegen übernehmen keine Verantwortung und haben auch nach homophoben Gewalttaten kein gesundes Unrechtsbewusstsein.
"STORCH vs. MERKEL: Unterschiedlicher kann die Meinung zu Ungarns "Homosexuellen-Gesetz" nicht sein"
Mobbing, ausagierter Hass und die Abwertung von anderen führen zur Ausschüttung von Adrenalin und Dopamin. Sie verleihen den Täter*innen ein rauschartiges Gefühl von Glück, Potenz, Stärke und Macht. Allerdings hält dies nicht an, weil die eigene Identität ja so brüchig und fragil ist, weshalb immer wieder der nächste narzisstische Kick der Abwertung anderer suchtartig gesucht werden muss.
Es braucht dann nicht selten immer stärkere Strategien. Dann werden mitunter aus Hasskommentaren auf Social-Media-Plattformen Anfeindungen im öffentlichen Raum oder sogar körperliche Gewalt.
Homophobe und trans*phobe Täter*innen traumatisieren sich letztlich bei jedem Gewaltakt ebenso selbst. Ausgelebter Hass kann uns zwar ein kurzes Gefühl von Macht, Rausch und fragiler Sicherheit im Identitätserleben geben. Allerdings hat dieses Ausagieren langfristig negative und destruktive Auswirkungen für Individuen, unsere Gesellschaft und damit letztlich auch für die Täter*innen. Es kommt zu einer Abwärtsspirale aus noch mehr ausgelebtem Hass und Abneigung.
Auch viele LGBTIQA* haben in sich selbst eine homophobe Seite
Wegen der heteronormativen Sozialisation und Erziehung und wegen sozialer Ausgrenzungsprozesse in der Familie oder im Freundes- und Arbeitsumfeld, aber auch durch Mobbing können LGBTIQA* Angst, Selbsthass, Scham und Abneigung gegen ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse entwickeln. Dabei handelt es sich um einen Schutzmechanismus, ein typisches Traumafolgesymptom, der in einem homophoben Kontext sinnvoll ist und oftmals Leib und Leben der Opfer bewahrt.
Innere und äußere Homophobie
Wir können somit zwischen innerer und äußerer Homophobie unterschieden. Die äußere Homophobie wird von System ausgeübt, etwa von der Judikative, von der Politik, von Parteien (etwa der FPÖ oder AfD), von Kirchen, Religionsgemeinschaften, Arbeitskolleg*innen oder Familien. Auch in den Medien wird Hass geschürt. Es ist viel leichter geworden, Hasskommentare zu posten.
Typisch ist hier die sogenannte "Triangulierung" einer Ideologie. Dies meint, dass Menschen sich auf etwas Drittes berufen, etwa auf den Glauben, die allgemeine Moral, die Bibel, den Koran, Gott, die Sitte oder auf den Schöpfungsmythos (Adam und Eva). Die Gefühle und primären Bedürfnisse der Menschen spielen dann keine Rolle mehr.
Neben dieser gesellschaftlichen Homonegativität finden wir aber auch eine innere (internalisierte). Diese spielt sich auf intrapsychischer Ebene ab und führt zu Emotionen wie massiver Angst, Ekel, Abscheu oder Hass gegenüber LGBTIQA*. Ohne verinnerlichter Homophobie gäbe es auch kein äußere. Auch viele LGBTIQA* leiden unter ihr.
Dennoch möchte ich an dieser Stelle zu bedenken geben, dass diese Emotionen überhaupt nicht problematisch sind, wenn wir sie utilisieren und gut mit ihnen umgehen. So tragen viele Personen eine verinnerlichte Homophobie in sich, d.h. aber nun nicht, dass sie diese auch gewaltsam ausagieren.
Als Psychotherapeut möchte ich immer dazu ermutigen, auf einer Metaebene alle Emotionen und destruktiven Impulse, darunter auch Hass und Abscheu, achtsam und mit Distanz zu beobachten. Dann geht es aber in einem zweiten Schritt darum, konstruktiv mit meinen Emotionen und Impulsen umzugehen, etwa indem ich mich mit meinen Ängsten auseinandersetze und den Dialog mit LGBTIQA* suche.
Auch wenn wir Homophobie psychologisch erklären und verstehen können, dürfen wir diese nicht rechtfertigen und schon gar nicht entschuldigen. Ausgelebte Homophobie ist ein Verbrechen gegen die Personenwürde, ist immer zu unterlassen und nie zu dulden. Ein angemessenes Sozialverhalten hat stets Vorrang vor der Psycho-Logik. Deshalb dürfen Staaten und die Gesetzgebung bei ausgelebter Homophobie auch nicht wegsehen, sondern müssen gegen sie aktiv werden. Ansonsten würden sie sich zu Mittätern machen.
Impulse, Affekte und Emotionen sind hier völlig nachrangig. Das homophobe Verhalten ist zu unterlassen und vom Gesetzgeber zu unterbinden. Ansonsten ließe sich das Ausagieren jedes Impulses rechtfertigen, was zu Anarchie führen würde. Ich kann auch meine alte Nachbarin nicht schlagen, nur weil ich durch körperliche Gewalt traumatisiert wurde und heute den Impuls dazu habe, andere zu verprügeln. Ich kann mich dann auch nicht herausreden, dass das an meiner Oma liegt, die mich immer verprügelt hat. Es wäre schlimm, dann zu sagen: "Ach so! Na dann mach ruhig weiter!". Ich kann alles verstehen, aber soziale Regeln und der Schutz vor Fremdschädigung haben stets Vorrang.
Wir sind somit für unsere Emotionen, Impulse und Gedanken nie verantwortlich, sehr wohl aber (immer) für unser Verhalten und unsere Taten.
Wir wissen aus den Studien von Theodor Adorno und den sozialpsychologischen Untersuchungen Arno Gruens, dass wir Täter*innen immer mit der vollen Kante der staatlichen Autorität begegnen sollten und sie in die Verantwortung bringen müssen, da Täter*innen Klarheit sowie Autorität benötigen, den sie aufgrund ihrer fragilen Identität nicht von sich aus aufbringen können. Der (Vater) Staat fungiert dabei mit seiner Exekutive und Judikative als ein Übergangsobjekt, dass Struktur und Halt gibt.
Im Gegenteil: Täter*innen legen es als Schwäche aus, wenn wir mit ihnen den Dialog auf selber Augenhöhe suchen. Traumatisierungen rechtfertigen in keiner Weise Gewalttaten. Zudem würden wir die Täter*innen nicht ernst nehmen und als erwachsene mündige Personen behandeln, wenn wir sie nicht zur Rechenschaft zögen. Der Staat fungiert hier als Erziehungsbeauftragter und erzieht Täter*innen nach.
Was kann mir helfen?
- Queerfreundliche Netzwerke und gute Freund*innen
- Beratungsangebote der Homosexuellen Initiativen
- Bei starker Ausprägung von verinnerlichter Homophobie sind Coaching, Psychotherapie, und Traumatherapie zu empfehlen.
Doku: "Mobbing in der Schule: Ich wurde gemobbt, weil ich queer bin!"
Homophobie in Schulen
Ich leiste seit 2008 sexualpädagogische Aufklärung in Schulklassen. Auch dort ist bereits internalisierte Homophobie zu beobachten. So erlebe ich in den letzten Jahren eine Zunahme der Negativität gegen LGBTIQA*, und dies nicht nur unter Burschen, sondern auch unter jungen Frauen (hier vor allem bei muslimischen Mädchen bzw. Frauen und solchen aus Freikirchen, da diese sehr heteronormativ, patriarchalisch und sexistisch sozialisiert werden). Bei Kindern und Jugendlichen begünstigen zudem psychische und körperliche Gewalt im Elternhaus homophobe Verhaltensweisen und Hass gegen alles Fremde. Was also Kinder und Jugendliche isoliert und einen kulturellen und sozialen Austausch minimiert, führt später meist zu negativen und hasserfüllten Projektionen.
Welche Auswirkungen hat homophober Hass auf LGBTIQA*?
Eine Studie aus dem Jahr 2022 belegt, dass bei Kindern und Jugendlichen, die LGBTIQA* sind, 45 Prozent über einen Suizid nachgedacht haben. Immerhin 14 Prozent haben einen Versuch unternommen. Damit ist die Selbstmordrate bei LGBTIQA*-Jugendlichen 4- bis 7-mal höher als bei heterosexuellen Personen derselben Altersgruppe.
Einen Grund dafür sehe ich darin, dass gerade junge Menschen, die in ihrer sexuellen Identität noch unsicher sind oder die vor kurzem erst ihr Coming-out hatten, sehr anfällig für Ablehnung und psychische Gewalt sind, zumal die Pubertät generell eine äußerst sensible Entwicklungsphase darstellt. Damit prägen Mobbing, psychische und physische Gewalt in dieser Phase ganz besonders. Ich arbeite immer wieder mit Erwachsenen, die wegen Mobbings und Ausgrenzung im sozialen wie auch im beruflichen Umfeld während ihrer Jugendzeit traumatisiert wurden und heute unter chronischen Traumafolgesymptomen (etwa Sucht, Depressionen, psychosomatischen Symptomen, Ängsten) leiden.
Aufgrund dieses ausagierten Hasses und zahlreicher Anfeindungen radikalisieren sich auch einige LGBTIQA*, zumal diese als Minderheit kollektiv traumatisiert sind und dann eigene Traumaerfahrungen (selbst wiederum ausagierend) weitergeben. Homophobe bzw. trans*phobe Menschen und LGBTIQA* gelangen dann in eine Spirale der Eskalation, Spaltung und Gewalt, die sich immer weiter hochschraubt.
Ich selbst bin dennoch für einen Dialog mit Menschen, die sich negativ gegenüber LGBTIQA* äußern bzw. verhalten, allerdings nur dann, wenn er konstruktiv bleibt und zu einer personalen Begegnung führt. Manchmal gelingt es hier dann durchaus, aus der Spirale der Gewalt auszusteigen und wichtige Aufklärungsarbeit zu leisten.
Wenn ich jedoch abgewertet oder sogar angefeindet werde, dann breche ich Gespräche ab und schütze mich vor psychischer und emotionaler Gewalt.
Wir brauchen mehr Identitäts-Bildung
Für mich stellt die Negativität gegenüber LGBTIQA* lediglich einen Eckpfeiler eines viel größeren Problems dar: Denn unsere Gesellschaft hat den richtigen Umgang mit Liebe, Sinnlichkeit, Erotik, Sexualität, Bindung, Autonomie und innerer Freiheit nicht gelernt, und nach wie vor gibt es viel Sexismus. So wird Mädchen und jungen Frauen gesagt, sie dürfen nicht den ersten Schritt machen. Sie müssten auf den Jungen warten und sich rarmachen. Burschen hingegen wird vermittelt, sie müssten starke, aktive Eroberer sein. Beide Genderrollen zwängen uns in ein enges Korsett und Prokrustesbett, was wiederum Homophobie und Negativität fördert.
Diese Stereotype und heteronormativen Vorgaben ziehen sich durch unsere gesamte Gesellschaft. Kinder und Jugendliche sind mit diesem Druck oft völlig einsam und isoliert. Dies wiederum führt zu innerseelischen und gesellschaftlichen Spaltungsmechanismen, zu mehr Ohnmacht, Angst und Hass.
Wir bedürfen als Gesellschaft viel mehr Aufklärung und Bildung bezüglich unserer Emotionen und Bedürfnisse. Ich bin davon überzeugt, dass wir nur dadurch Ausgrenzung, Anfeindungen und ausgelebten Hass vermindern können. Diese Bildung sollte spätestens ab dem Kindergarten beginnen, wobei auch die Eltern und Familien systemisch einbezogen werden müssen. In der Grundschule sollte dann gewaltfreie Kommunikation gelehrt werden, und auf welche Weise wir in einen personalen Dialog treten und Unterschiede aushalten können. Emotionen und primäre Bedürfnisse (etwa Halt, Orientierung, Sicherheit, Nähe, Wertschätzung, Verbundenheit, Liebe) im Gegensatz zu sekundären Bedürfnissen (Anerkennung durch Leistung, Konsum, Verwöhnung, Sucht, Missbrauch von Substanzen) müssen in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt werden.
Zudem sollten wir von klein auf lernen, Spannungen, Widersprüche, Ambivalenzen und Unterschiede gut auszuhalten, konstruktiv damit umzugehen und in einen guten Dialog zu treten. Die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg sollte in den Mittelpunkt der schulischen und universitären Kommunikation gerückt werden.
Dies bedarf auch der Arbeit mit den Eltern und Familiensystemen, weil es zu wenig ist, wenn nur die Kinder lernen, ihre Bedürfnisse, ihre Emotionen und ihren Körper zu spüren und dann am Abend in Familien kommen, wo die Eltern das nicht tun bzw. können. In diesem Fall könnten die Auswirkungen für die Kinder sogar negativ sein. Ich lerne in Kindergarten und Schule, mich selbst zu spüren und bekomme dann daheim eine auf den Deckel.
Finanziell würde sich dieses Modell auf alle Fälle auszahlen, denn die Folgekosten für eine narzisstische, postmoderne Gesellschaft, die keinen Zugang zu ihrem Spüren, zu ihrem gesunden Selbsterleben, Selbstwert und zu ihren primären Bedürfnissen hat, sind enorm. Psychische, psychosomatische und somatoforme Erkrankungen wie Ängste, Sucht, Substanzmissbrauch, Depressionen, chronische Schmerzen, Homophobie und Traumafolgesymptome verursachen einen enormen volkswirtschaftlichen Schaden. Krankentage, Kuren, Rehabilitationen, Psychotherapien, psychiatrische Aufenthalte, Suchtbehandlungen, Kliniken, die justizielle und exekutive Verfolgung von Straftäter*innen und Beschaffungskriminalität kosten uns allen viel mehr als dies mein oben vorgestelltes Schulfach und eine präventive Familienberatung für alle täten.
Es braucht sowohl von oben aus der Politik, als auch von unten der Basis der Gesellschaft ein entschlossenes und konsequentes Umdenken und Handeln gegen Homophobie und FÜR Menschenrechte und die Personenwürde. Dabei ist zu bedenken, dass die Religionsfreiheit der Personenwürde untergeordnet ist und Religionen niemals die Freiheit ihrer Gläubigen einschränken dürfen. Ausgrenzung, ausgelebter Hass, Populismus, Unverständnis und Spaltung der Gesellschaft schaden uns allen nachhaltig, führen zu kollektiven Traumen und massiven Folgeschäden einer Kultur und Sozietät.
Die Politik und Staatsgewalt sind hier gefordert, denn wir haben die Menschenrechtskonventionen unterschrieben und müssen auch rechtlichen Schutz sichern, der für Freiheit steht.