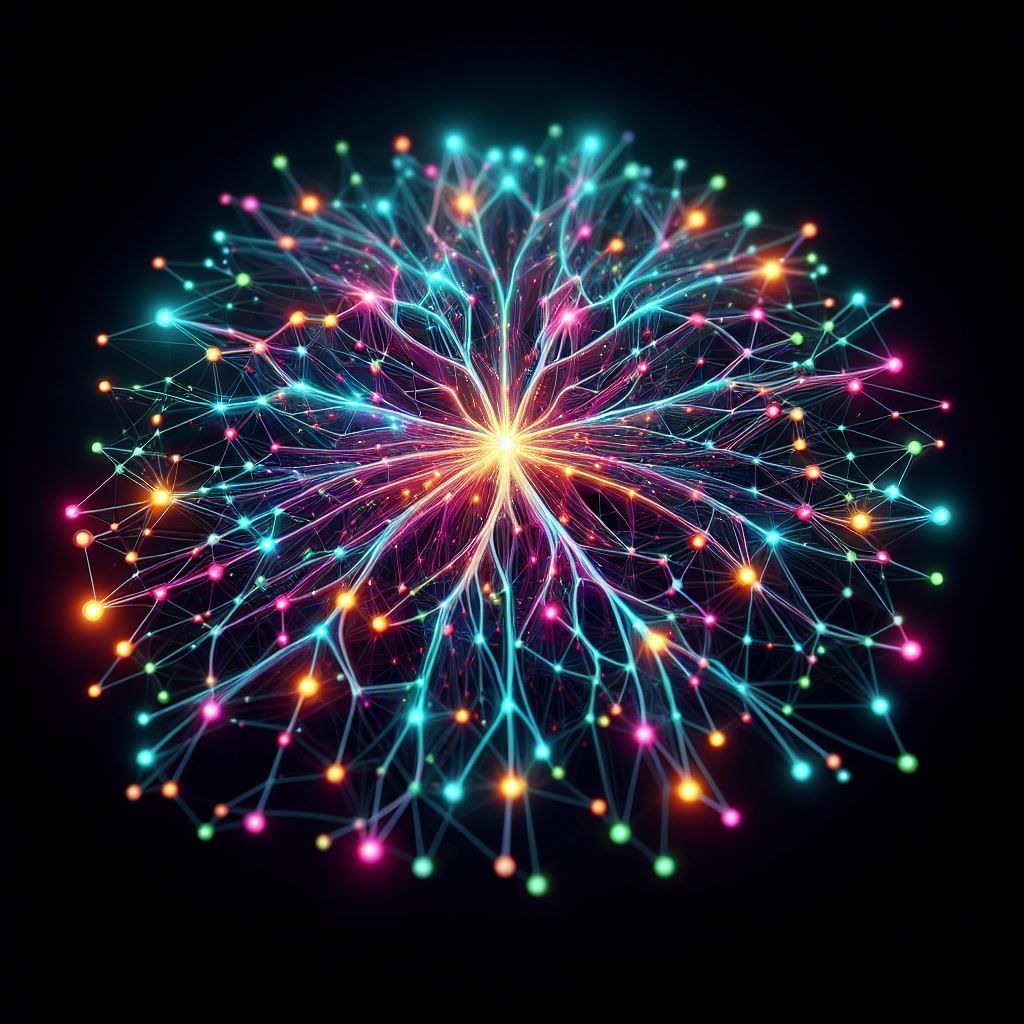Meine Motivation mit trans*Menschen zu arbeiten
Was bewegt einen cis-Mann wie mich, als Psychotherapeut mit trans*identen Menschen zu arbeiten?
Und wie habe ich herausgefunden, dass ich cis, also geschlechtseuphorisch bin?
Lesen Sie in diesem Essay über meine Motivation, mit trans*Menschen zu arbeiten.
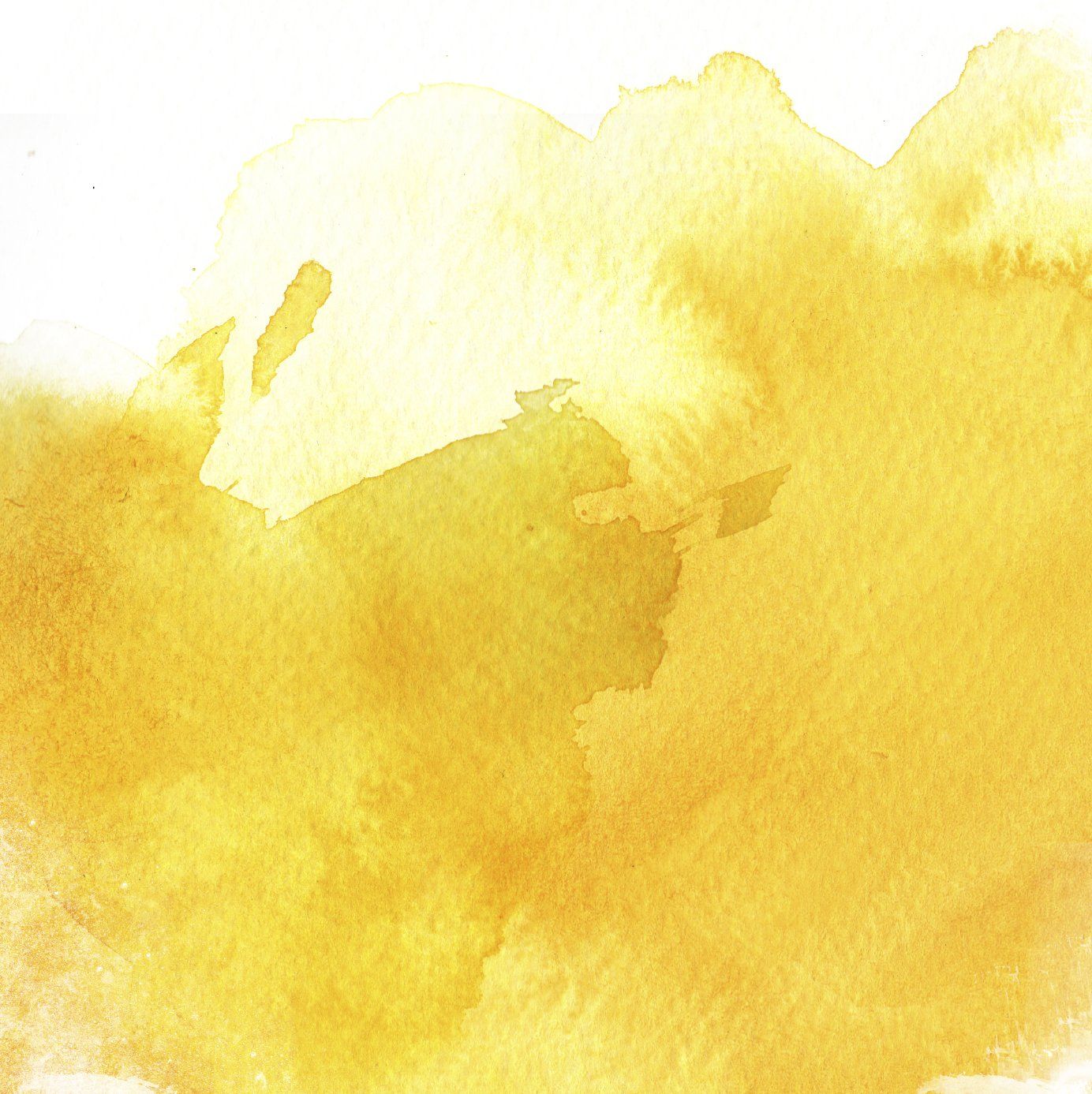
Meine konservativen Ursprünge
Ich stamme aus einem konservativen Elternhaus und wurde wie die meisten Menschen, die in den 1980er Jahren geboren wurden, heteronormativ erzogen. Als ich mir als Kind für meinen Teddybären einen Puppenwagen wünschte, haben mir meine Eltern diesen verweigert, weil das peinlich für einen Buben sei, besonders in der Öffentlichkeit. Ich kann mich noch erinnern, dass ich dann lästig wurde. Ich empfand Wut, Trauer, Trotz und Ärger. Zudem wurde der Puppenwagen gerade durch das massive Verbot nun erst recht interessant und umso mehr zu einer Fixidee für mich. Diese Fixierung auf das Verbot versuchten meine Eltern aufzulösen, indem sie mir einen Minieinkaufswagen schenkten, in dem ich meine Teddybären durch die Gegend und auf den Spielplatz schieben durfte.
Kindlicher Protest und Rebellion
Meine Copingreaktionen während meiner Kindheit waren unter anderem Trotz und Rebellion. Im Kindergartenalter wollte ich mich dann zu Hause immer wieder als Mädchen, Prinzessin oder Engerl verkleiden, was ich mir im Nachhinein mit ebendiesen Copingreaktionen erkläre: Ich spürte damals schon, dass das nicht ganz fair war, was mir Erziehung, Sozialisation und Gesellschaft als männliche Rolle auferlegen wollten. Bedauerlicherweise gab es während meiner Kindheit noch keinerlei Pädagogik, welche die Heteronormativität infrage stellte. Heute ist das anders und es gibt zahlreiche Kinderfilme, Kinderbücher und pädagogische Materialien, in denen über Heteronormativität aufgeklärt wird und sogar trans*Identität und Geschlechtsdysphorie thematisiert werden.
Ich wollte als Kind nie ernsthaft und dauerhaft das andere Geschlecht sein, wie das bei trans*Kindern der Fall ist. Das Ganze war für mich ein spielerisches sich-Ausprobieren und eben jene Rebellion, wie ich sie oben erwähnte. Mal war ich Prinzessin, dann wieder Räuber, Indianer oder Pirat. Diesbezüglich durfte ich meine verschiedenen Seiten leben, solange es in den eigenen vier Wänden geschah.
In der Volksschulzeit wurden meine Eltern zunehmend liberaler, was die Genderrolle betraf. Zwar sagte mir mein Vater ein paar Mal, dass ein richtiger Bub nicht weinen solle, meine Mutter vermittelte mir allerdings ein moderneres Männerbild, zumal ich meinen Vater auch mehrmals weinen sah. Auch was die autoerotische Erkundung des eigenen Körpers und Selbstbefriedigung betraf, waren meine Eltern liberal und modern. In der Grundschulzeit durfte ich dann nicht nur mit Lego und Playmobil, sondern auch mit Barbiepuppen und anderen Puppen spielen. Diese Freiheit genoss ich sehr.
Pubertärer Widerstand gegen heteronormative Männerrollen
In und nach der Pubertät spürte ich oft inneren Widerstand, Trotz und Rebellion gegen die doch sehr starre Genderrolle, die von Burschen und Männern erwartet wurde. So ließ ich mir aus Protest eine Zeitlang meine Haare lang wachsen und wollte mich etwas androgyner kleiden. Ich hätte mich wohl in der Identitätsschablone "genderfluid" wohlgefühlt, die es aber damals noch nicht gab. Zugleich freute ich mich aber über meinen Körper und über meine sich ausbildenden sekundären männlichen Geschlechtsmerkmale, wenn auch ich als Teenager noch ziemlich „gschamig“ war.
Trans*Identität war damals kaum in meinem Bewusstsein. Zwar war Mitte und Ende der 1990er Jahre Homosexualität bereits ein großes gesellschaftliches Thema (immerhin war Anfang der 1990er Jahre Homosexualität endlich aus dem Katalog der psychischen Erkrankungen gestrichen worden), über trans*Geschlechtlichkeit hingegen wurde in der Schule und in den Medien kaum gesprochen und wenn, dann wurde sie oft mit Homosexualität gleichgesetzt oder vermischt.
Mit 18 Jahren spürte ich zunehmend Ärger aber auch Trotz, wenn trans*Identität mit Homosexualität gleichgesetzt wurde. Damals galten schwule und bisexuelle Männer noch oft als heimliche Frauen und lesbische/bisexuelle Frauen als heimliche Männer und ich verstand diese Fehlschlüsse weder emotional noch rational. Auch das Vorurteil, dass in homosexuellen Partnerschaften immer einer/eine die Rolle des Mannes und der/die andere die Rolle der Frau übernehmen müsse, war mir nicht einsichtig. Ich merkte aber, dass viele homo- und bisexuelle Menschen diese Vorurteile internalisierten und dieses Labeling unbewusst übernahmen, weil es von ihnen erwartet wurde. Ich verspürte dann, unreflektiert und ohne jede Selbsterfahrung, wie ich damals war, Abscheu gegenüber Menschen, welche dieses Labeling unbewusst übernahmen und machte mich als Teenager über sie lustig.
Die oben etwas ironisch gestellte Frage, wie ich gemerkt habe, cis* bzw. cissexuell zu sein, kann ich dahingehend beantworten, dass ich es nicht weiß. Rein zufällig hat das mir bei der Geburt zugewiesene Geschlecht mit meiner Geschlechtsidentität übereingestimmt. Rebelliert habe ich jedoch gegen die heteronormative Erziehung.
Meine Erfahrungen als junger Erwachsener und meine ersten beruflichen Tätigkeiten mit trans*identen Menschen
Meine erste Begegnung mit einem trans*Menschen war im Alter von 22 Jahren. Ich lernte beim Fortgehen eine trans*Frau kennen und stelle ihr aus Interesse ein paar Fragen zu ihrem Coming-out, ihrem Leben und wie es möglich sei, den Personenstand zu ändern. Ich hatte damals in meiner Gegenübertragung noch Gefühle der Angst und Unsicherheit, war ich doch patriarchalisch und heteronormativ erzogen und sozialisiert worden und trans*Geschlechtlichkeit stellte mein Weltbild völlig auf den Kopf. Diese Unsicherheit hat sich jedoch im Laufe des Gesprächs rasch gelegt und wurde mit jeder Begegnung mit einer trans* Person immer noch geringer.
Richtig tiefgehend beschäftigte ich mich mit Geschlechtsdysphorie allerdings erst zehn Jahre später, als ich begann als psychologischer Berater und Sexualpädagoge in der Aidshilfe Salzburg zu arbeiten. Parallel zu meiner hauptberuflichen Tätigkeit in der Aidshilfe war ich von 2011 bis 2014 ehrenamtlich im Beratungsteam der
Homosexuellen Initiative Salzburg (HOSI) tätig. Wir haben schwule Männer, lesbische Frauen, bisexuelle Menschen, intersexuelle Menschen, transidente Menschen und deren Angehörige beraten. Zudem hatte ich dort einige trans*idente Kolleginnen* und Kollegen*, von denen ich viel lernte.
Ich las mich damals als Autodidakt in die einschlägige aktuelle Fachliteratur ein und erwarb mir dadurch viel Fachwissen zu trans*Identität.
Meine Selbsterfahrung mit trans*Theaterrollen
2014 spielte ich als freischaffender Schauspieler in dem Theaterstück DER KÖNIG STIRBT von Eugenè Ionosco die Nebenrolle des Hausmädchens. Dafür trug ich ein Kleid, hatte allerdings auch Vollbart und war völlig ungeschminkt, ich spielte somit eine genderfluide, diverese Person.
Zwei Jahre später spielte ich mit der
ENGLISH DRAMA GROUP SALZBURG in einem Sketch eine trans*Frau mit blonder Perücke, viel Schminke und Maske und einem eher spießigen, konservativen Outfit. Diese Rolle war in puncto Selbsterfahrung sehr wertvoll für mich, da ich in der Pause auf die Toilette musste. Die Aufführung des Theaterabends der ENGLISH DRAMA GROUP SALZBURG fand im Unipark Nonntal statt, wo am selben Abend Burschenschaftler ein Treffen hatten. Ich ging also mit dem Kostüm und der Maske meiner trans*Frauenrolle auf das Männer-WC, wo auch ein paar Burschenschaftler waren, die nicht mitgekriegt hatten, dass eine Theateraufführung im Haus stattfand.
Meine Selbsterfahrung war ziemlich unangenehm: Peinlichkeit, Scham sind die Gefühle, die bei mir besonders präsent waren und ich fragte mich, wie trans*Menschen jeden Tag mit derartigen Situationen und Gefühlen umgehen können. Immerhin fiel ja bei mir zumindest die Kränkung weg, weil es nicht um meine Identität ging. Obwohl ich wusste, dass ich an diesem Abend lediglich ein Kostüm trug und ansonsten ein relativ selbstsicherer cis Mann bin, der sich in seinem männlichen Körper wohlfühlt und gerne ein Mann ist, veränderte die Situation und die Reaktionen des sozialen Umfeldes meine ganze Stimmung. Von den Burschenschaftlern kamen keine direkten Angriffe, aber sie tuschelten, waren peinlich berührt oder sahen aktiv und bemüht weg, was es für mich noch schlimmer machte. Ich stand im Mittelpunkt, obwohl ich in einer Situation war, in der ich keinesfalls im Mittelpunkt stehen wollte. Wie unangenehm und verletzend muss erst eine derartige Situation für eine trans*Frau sein, die sich ja in ihrem tiefsten Innersten immer als eine Frau fühlt? Hier kommt dann auch noch die schwere Kränkung hinzu, die entsteht, wenn ein Mensch nicht als das Geschlecht angesehen wird, als welches er sich fühlt.
Meine Abschlussarbeiten und Publikationen zu trans*Identität
Nach dieser Selbsterfahrung beschäftigte ich mich dann wieder wissenschaftlich mit trans*Identität und schrieb 2015 in meinem zweiten Studium eine Bachelorarbeit zum Thema trans*Geschlechtlichkeit in der Sozialen Arbeit und Psychotherapie. In der Arbeit ging es darum, dass trans*Identität bis heute in den Sozialwissenschaften und in der Psychotherapie ein Forschungsdesiderat darstellt. Es gab damals kaum Fachliteratur (einer der wenigen Autoren, die emsig publizierten, war der von mir hochgeschätzte Udo Rauchfleisch) oder wissenschaftliche Publikationen dazu. Heute, nur sieben Jahre später, hat sich die Situation geändert: Es gibt mittlerweile zahlreiche fundierte Fachpublikationen, und jedes Jahr erscheinen im deutschsprachigen Raum Monographien und Handbücher, die sich an Psycholog*innen, Psychotherapeut*innen, Pädagog*innen, Ärzt*innen und helfende Berufe richten.
Jedoch ist Geschlechtsdysphorie in der Ausbildung von Psychotherapeut*innen und helfenden Berufen noch immer kaum ein Thema. Es gibt nur wenig Fortbildungen und die Möglichkeit, bezüglich Sex und Gender Selbsterfahrung zu sammeln, ist kaum gegeben. Mein Kollege Karl Sibelius aus Linz und ich planen daher für 2023 eine umfassende Weiterbildung für Psychotherapeut*innen zu trans*Identitäten.
Da ich schon lange beruflich mit Randgruppen und marginalisierten Minderheiten arbeite und durch meine bisherige Arbeit einige berufliche Kontakte zu trans*Menschen knüpfen konnte, habe ich vor ein paar Jahren beschlossen, mich auch der trans*Identität vermehrt zuzuwenden und die Arbeit mit trans*Personen in mein Beratungsangebot aufzunehmen.
2022 habe ich meine Abschlussarbeit "Existenzanalytische Zugänge zum Phänomen der trans*Identität" für die Ausbildung zum Psychotherapeuten verfasst, in der ich herausgearbeitet habe, inwiefern wir als Psychotherapeut*innen trans*idente Personen optimal unterstützen können.
Ich werde auch in Zukunft trans*Menschen auf ihrem Weg begleiten und, sobald ich mit meiner Ausbildung fertig bin, Stellungnahmen für Hormontherapien und körpermodifizierende Maßnahmen schreiben. Trans*Personen, die wirtschaftlich schwach sind und ein geringes Einkommen haben, bekommen ab 2023 bei mir kostenlose Therapieplätze, wenn sie über die ÖGK versichert sind.
Was ich von meinen Klient*innen lerne
Heute konfrontieren mich meine trans*Klient*innen immer wieder mit meinen eigenen Konstrukten und meinem Verständnis von Männlichkeit und Weiblichkeit. Als Sozialwissenschaftler und Psychotherapeut weiß ich natürlich, dass Genderrollen und was wir unter „männlich“ oder „weiblich“ verstehen stark von der jeweiligen Gesellschaft, der Kultur und der Zeit in der wir leben, bestimmt und konstruiert werden. Ich gebe der Philosophin Judith Butler recht, wenn sie schreibt, dass wir jeden Tag die Rollen von Männlichkeit und Weiblichkeit spielen (Performanz), die uns die Gesellschaft zuweisen.
In diesen Thesen liegt jedoch die Gefahr, dass wir zu sehr rationalisieren und vernünfteln, wenn es um das Erleben unserer eigenen Weiblichkeit bzw. Männlichkeit geht. Deshalb widerspreche ich Judith Butler, wenn sie postuliert, dass auch die Idee des weiblichen oder männlichen Körpers ein Konstrukt sei. Abgesehen, dass diese Idee selbst nur ein Konstrukt und eine Ideologie ist, erleben wir uns ja nie als ein Konstrukt (es sei denn, wir befinden uns in einem psychotischen Zustand). Wir erleben uns immer mit einem Körper (die Existenzanalyse spricht hier etwas poetischer vom „Leib“). Selbst wenn der Körper nur ein Konstrukt wäre, er spürt sich für uns real und zu uns gehörig an. Insofern ist er wesentlich in unserem Leben.
So spüre ich meinen Körper tagtäglich und fast allgegenwärtig. Der Körper spielt in der Psychotherapie eine entscheidende Rolle, wobei viele Menschen einen eher mittelmäßigen bis schlechten Zugang zu ihrem Körper haben oder ihn sogar vernachlässigen. Ich selbst arbeite daher in der Psychotherapie viel mit körpertherapeutischen Ansätzen und Atemübungen, und in meinem zweiten Beruf als Schauspieler und Sänger ist der Körper ebenso essenziell.
Wie wir unseren Körper erleben
Um die Frage, ob ich meinen Körper als männlich, als weiblich oder irgendwo dazwischen erlebe, kommt kein Mensch herum. Somit erfahren wir uns auch jeden Tag als männlich, als weiblich, als genderfluid, als trans*, als cis und vieles mehr. Butlers Thesen scheinen mir hier schon sehr verkopft (wenn auch ich sie in mehreren Beiträgen meines Blogs würdige, weil sie wichtige Fragen aufwirft), und sie werden immer wieder ideologisch missbraucht. Es geht um die Idee, um das Konstrukt, aber nicht um unser subjektives Erleben und Spüren unseres Leibes.
Bei all meinen trans*identen Klient*innen mache ich immer wieder die Erfahrung, dass der eigene Körper eine wesentliche Rolle spielt. Mal wird er trotz der trans*Identität bejaht, mal abgewertet, mal als ambivalent erlebt.
Selbstverständlich hinterfrage ich in meiner Arbeit als Psychotherapeut Konstrukte von Männlichkeit und Weiblichkeit. Dabei stoße ich immer wieder auf die Selbsterfahrung und die Frage, wie ich selber als gendereuphorischer Mann mich als männlich fühle. Ich komme dabei zu der vorläufigen Antwort, dass ich für mich nicht präzise formulieren kann, was Männlichkeit für mich ausmacht. Ich habe viele „männliche“ und „weibliche“ Seiten, zu denen ich einen guten Zugang habe. Ich spüre Zufriedenheit und innere Zustimmung zu meinem männlichen Körper und mag meine primären und sekundären männlichen Geschlechtsmerkmale. Auch macht es mich manchmal zornig, wenn mich andere Menschen darauf hinweisen, wie sich ein „richtiger Mann“ zu verhalten habe. Ich fühle mich dann in meiner männlichen Identität nicht gesehen und bevormundet, was mich kränkt und verletzt. Ich empfinde das zudem als eine massive Grenzüberschreitung, weil nur ich mir selbst zuschreiben kann, was sich für mich als männlich anfühlt.
Grenzüberschreitungen und Gaslighting
Als genauso grenzüberschreitend empfinde ich es, wenn trans* Menschen ihre Männlichkeit oder Weiblichkeit abgesprochen wird oder wenn ihnen sogar eingeredet wird, dass ihre Bedürfnisse und Emotionen falsch seien. Hierbei handelt es sich nicht nur um eine schwere Verletzung der Integrität und Personenwürde, sondern auch um psychischen Missbrauch und um Gaslighting. Ob und wie sich ein Mensch fühlt, spürt nur er selbst. Zudem können Gefühle nie richtig oder falsch sein, Gefühle sind wie sie sind.
Jede gegenteilige Behauptung, etwa die Unterstellung, trans* Menschen sollten einfach lernen, zu akzeptieren, dass sie nicht in dem von ihnen erlebten Geschlecht leben können oder sich mit ihrem Geburtsgeschlecht aussöhnen, führt Menschen auf Abwege, zu einem unauthentischen, apersonalen, sinnleeren Leben und zu einem falschen Selbst.