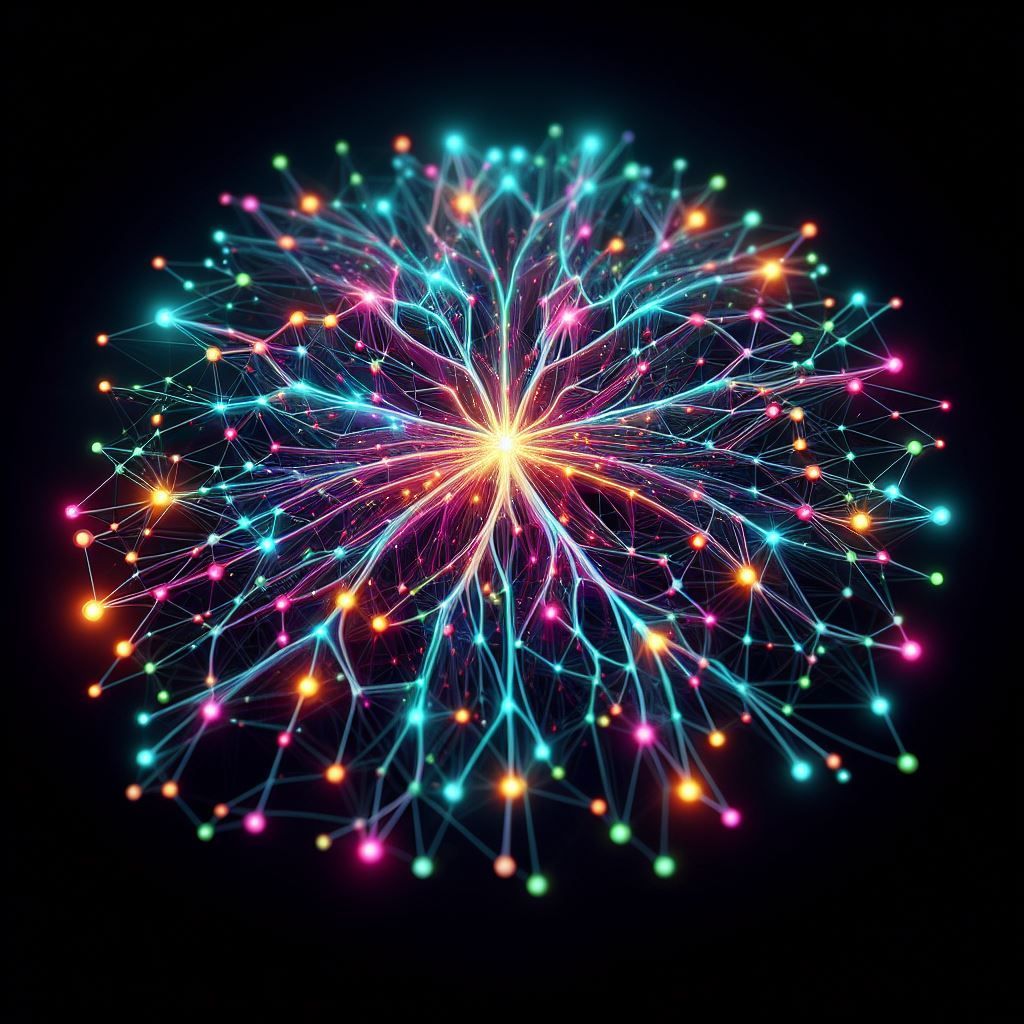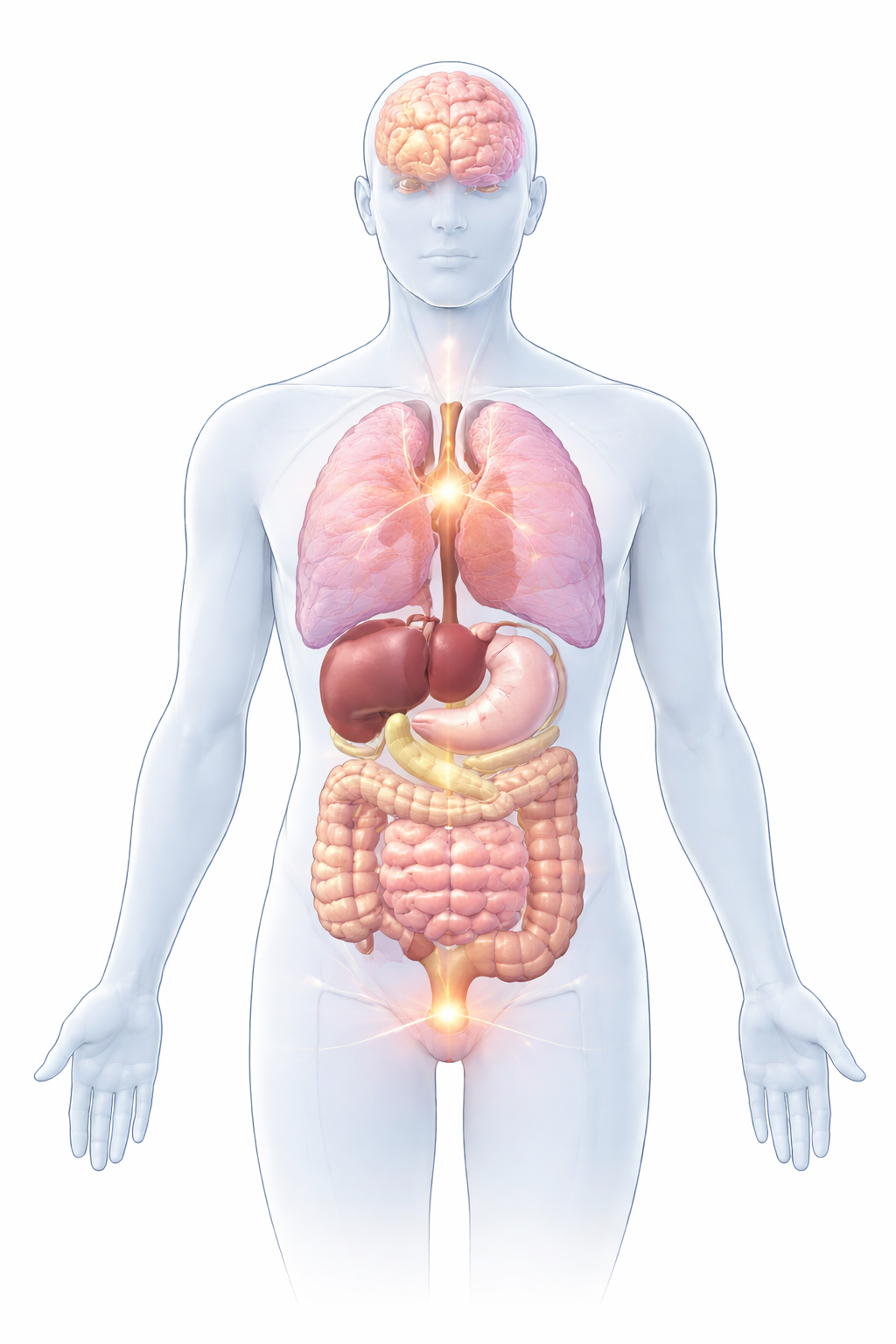Die Bevorzugung von FLINT* durch die ÖH der Uni Salzburg
Rechtswidrige Bevorzugung von FLINT*
FLINT* steht für Frauen, Lesben, Intersexuelle, nicht-binäre Personen und trans*idente Menschen.
Ursprünglich hatte die Österreichische Hochschüler*innenschaft (ÖH) der Uni Salzburg geplant, dass im Sinne der Gleichbehandlung bei einer
Ausschreibung von Referent*innenstellen FLINT* Personen zu bevorzugen sind. Die Ausschreibung des Postens im Referat für Genderfragen erfolgte durch die
GRAS (grüne und alternative Student_innen). Das Bildungsministerium hat dieses Vorgehen nun als rechtswidrig aufgehoben. Die ÖH-Satzung decke nämlich nicht ein solches Vorgehen, so das Ministerium.

Meine Statements
Aus psychologischer und gesellschaftspolitischer Sicht finde ich ein derartiges Vorgehen äußerst kontraproduktiv, weil sich hier die LGBTIQA* Community selbst spaltet und kollektive Traumen und Minderheitenstress reproduziert werden. Ich habe folgende Statements an die ÖH Salzburg gerichtet:
Statement 1
Als Mitarbeiter einer NGO, die sich für die Rechte von LGBTIQA* einsetzt und als Psychotherapeut mit dem Schwerpunkt LGBTIQA* sehe ich die Gefahr, dass hier gewaltvolle gesellschaftliche Machtverhältnisse vom anderen Ende her reproduziert werden. Es ist definitiv schwere psychische Gewalt, wenn FLINT* stigmatisiert und diskriminiert werden. Um dieser Gewalt entgegenzuwirken, bedarf es nicht des Ausschlusses von Cis-Männern, sondern deren Einbindung und Integration.
Cis-Männer auszuschließen wäre ebenfalls wiederum (schwere) psychische Gewalt. Die Opfer (die FLINT* zweifellos fast immer waren oder sind) werden dabei selbst psychisch missbräuchlich und geben die erlittene Gewalt nun unbewusst weiter, werden selbst zu Täter*innen.
Als Psychotherapeut muss ich in meiner täglichen Arbeit immer wieder erleben, wie rasch die eigenen Traumatisierungen, Kränkungen, Stigmatisierungen und das psychische Leid an andere Menschen weitergegeben werden, in der Regel völlig unbewusst. Mir sind noch keine Täter*innen begegnet, die nicht selbst Opfer von Gewalt bzw. selbst schwer traumatisiert waren.
Verfolgte Minderheiten geben ihren Minderheitenstress in der Regel an andere weiter. Cis-Männer auszuschließen bleibt für mich ein Akt psychischer, sozialer Gewalt und Diskriminierung. Cis-Männer werden somit selber zu einer Minderheit gemacht, die weniger Rechte bekommt, wie etwa eine berufliche Position, ein Amt, eine Stelle. Hier wird die ursprüngliche Diskriminierung definitiv reinszeniert.
In der Organisationspsychologie ist es altbekannt, dass Institute, Einrichtungen oder NGOs, die mit traumatisierten Minderheiten arbeiten, aber auch Selbsthilfegruppen von verfolgten und diskriminierten Minderheiten Gefahr laufen, Gewalt zu reproduzieren. Diese Gefahr sehe ich auch im Fall der ÖH-Stellenausschreibung gegeben, wenn eine Gruppe von Personen (hier cis-Männer) zu einer Minderheit gemacht wird, die weniger Rechte bekommt und von Stellen bzw. Ämtern ausgeschlossen wird.
Zur Vertiefung in das Weitergeben von Traumen findet sich noch hier ein Text von mir.
Film: "Was bedeutet LGBTI*?"
Statement 2
Als Psychotherapeut mit der Spezialisierung Antidiskriminierung und Gewaltprävention, der immer wieder gerne mit der ÖH zusammenarbeitet, ist es mir noch einmal wichtig, zu betonen, dass die Bevorzugung von FLINT* und der Ausschluss von bisexuellen, schwulen und cis-Männern stigmatisierend und repressiv ist. Wie schon geschrieben handelt es sich dabei für schwule und bisexuelle Männer um eine intersektionelle Diskriminierung: Diskriminierung wegen des Geschlechts, aber auch wegen der sexuellen Orientierung, da ja schwule und bisexuelle Männer selber einer Minderheit angehören und somit in der Regel noch immer viele leidvolle, kränkende Erfahrungen von Stigmatisierung in ihrer Biografie aufweisen, die hier wieder aufbrechen können.
Auch schwule und bisexuelle Männer werden durch patriarchalische und heteronormative Systeme schwer diskriminiert. Diskriminierungen, physische und psychische Gewalt können Menschen traumatisieren und psychische und gesundheitliche Folgeschäden nach sich ziehen (etwa Substanzmissbrauch, eine Posttraumatische Belastungsstörung, Traumafolgestörungen und chronische Persönlichkeitsveränderungen aufgrund von Traumatisierungen).
Umgekehrt habe ich in meiner Arbeit auch immer wieder Klient*innen, die von cis-Frauen schwer trans*negativ/homonegativ diskriminiert oder traumatisiert wurden. Trans*phobie und Homophobie sind keine Frage des Geschlechts.
Ich begrüße daher den Bescheid des Bundesministeriums, weil ich in der Bevorzugung von FLINT* einen gefährlichen Spaltungsprozess innerhalb der LGBTIQA* Community sehe, der der gemeinsamen Sache nicht dienlich ist und sogar heteronormativen und patriarchalischen Ideologien und Strukturen in die Hände spielt.
Traumatisierte Menschen und Minderheiten solidarisieren sich in der Regel nicht, weil sie die erfahrene Gewalt in ihr Inneres hineingenommen haben. So diskriminieren z.B. schwule Männer immer wieder lesbische Frauen und umgekehrt, oder lesbische Frauen und schwule Männer werten bisexuelle Menschen oder trans*Personen ab. Auch innerhalb der Community von trans*Menschen kommt es zu psychischer Gewalt, Ausgrenzung, Spaltung und Diskriminierung. Diese Spaltungsprozesse bilden sich m.E. in der Bevorzugung von FLINT* ab.